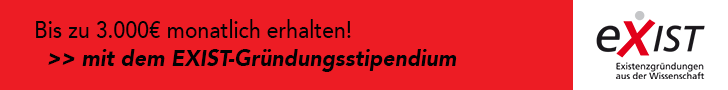Bildnachweis: Silvia Hänig.
Viele Potenziale im Start-up-Sektor lassen sich nicht allein auf nationaler Ebene heben. Europa braucht eine engere Zusammenarbeit, um gemeinsam Investitionen anzukurbeln, einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Synergien zu nutzen. Genau dafür hat Encourage Ventures sein Positionspapier entwickelt – mit dem Ziel, das gesamte Start-up- und Investment-Ökosystem in Europa zu stärken und Innovationskraft voll auszuschöpfen.
Innovation, Talente, Kapital und fairer Wettbewerb sind die vier wesentlichen Säulen, um Start-ups aus Europa erfolgreich zu machen. Dabei ist Diversität in der Gründer- und Investorenlandschaft essenziell. Eigentlich. Allerdings zeigen die Zahlen, dass es in Deutschland immer noch eine begrenzte Vielfalt gibt (18,8 % weibliche Gründerinnen und 15 % weibliche Business Angels), was wiederum negative Folgen für den Innovationsstandort nach sich zieht: Einseitige Investmententscheidungen, unzureichende Verfügbarkeit von Wagniskapital, mangelhafte Perspektivenvielfalt und last but not least fehlende steuerliche Anreize. Daher stellt der Verein Encourage Ventures (über 1.200 angeschlossene weiblich geführte Start-ups und über 700 weibliche Business Angels) konkrete Maßnahmen vor, um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Impact von Gründerinnen und Investorinnen zu stärken, bestehende Hürden abzubauen und zukunftsfähige Geschäftsmodelle in die Umsetzung zu bringen.
1. Bürokratie abbauen und Gründen vereinfachen
Hohe Kosten, bürokratische Hürden und langsame Genehmigungsprozesse erschweren Unternehmensgründungen in Deutschland. Im internationalen Vergleich schneidet das Land schlecht ab, was potenzielle Gründer*innen abschreckt, und das Wachstum bestehender Start-ups bremst.
2. Mehr Venture Capital mobilisieren
Der deutsche Venture-Capital-Markt bleibt eindeutig hinter seinem Potenzial zurück: Nur 0,17 % des Bruttoinlandprodukts fließt in Wagniskapital – weit weniger als in Frankreich oder den USA. Um mehr privates Kapital zu mobilisieren, muss das Chancen-Risiko-Verhältnis von Wachstumsinvestitionen besser vermittelt werden. Zudem herrscht in Deutschland eine kulturelle Skepsis gegenüber Wagniskapital. Venture Capital wird noch zu oft mit kurzfristigen Gewinnen und Intransparenz assoziiert. Dabei handelt es sich tatsächlich um langfristige Investitionen in innovative Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Ganz besonders im Umfeld von Climate Tech, Deep Tech oder Health Tech gibt es hohe gesellschaftliche Nutzen.
3. Zugang zu Wagniskapital erleichtern und fair gestalten
Start-ups in der Wachstumsphase erhalten im internationalen Vergleich weniger Kapital, insbesondere gegenüber den USA. Besonders benachteiligt sind von Frauen oder diversen Teams geführte Start-ups, die deutlich weniger Wagniskapital bekommen. Diese Finanzierungsdefizite bremsen sowohl das Wachstum innovativer Unternehmen als auch die Entwicklung eines vielfältigen und wettbewerbsfähigen Innovationsökosystems. Es braucht einen besseren Zugang und faire Bedingungen.
4. Entrepreneurial Mindset an Hochschulen stärken
Trotz vieler guter Hochschul-Initiativen hat die Gründungslehre an deutschen Schulen und Hochschulen noch eine geringe Bedeutung. Aus diesem Grund schneidet Deutschland im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich im Bereich Entrepreneurship ab. Fehlende Sichtbarkeit von Gründungen als reelle Karriereoption sowie unzureichende Strukturen und Unterstützung für die Kommerzialisierung wissenschaftlicher Innovationen lassen wirtschaftliches Potenzial ungenutzt.
5. MINT-Berufe für Frauen attraktiv machen und Förderprogramme wettbewerbsfähig gestalten
Der Fachkräftemangel, besonders im Tech-Bereich, bremst das Wachstum von Start-ups in Deutschland. Besonders problematisch ist die geringe Frauenquote in MINT-Berufen, mit nur 22 % der Tech-Jobs in Europa. Das ist nicht nur eine Frage der Gleichstellung, sondern hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Studien zeigen, dass ein höherer Frauenanteil das BIP Europas bis 2027 um bis zu 600 Milliarden EUR steigern könnte. Zudem bleibt der Transfer von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte eine Herausforderung. Im Vergleich zu Ländern wie Singapur sind deutsche Programme wie EXIST oder die Forschungszulage international weniger wettbewerbsfähig. Eine verstärkte Förderung von Frauen in MINT-Berufen sowie attraktivere, international konkurrenzfähige Förderprogramme für die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen sind notwendig, um Start-ups langfristig zu stärken.
6. Börsengänge und Anschlussfinanzierungen stärken
Ein schwacher Kapitalmarkt und eingeschränkte Möglichkeiten für Börsengänge hemmen das Wachstum für Start-ups in Deutschland enorm. Im Vergleich zu anderen Ländern wurden laut einer Erhebung von PwC aus dem Jahr 2024 gerade einmal fünf Börsengänge umgesetzt. Um den Übergang von der Wachstums- in die Skalierungsphase bewältigen zu können, braucht es eine systematische und konsequente Anschlussfinanzierung. Ansonsten wandern vielversprechende Start-, oder Scale-ups ins Ausland ab.
7. Innovationspotenziale heben anstatt versenken
Die aufgeführten Maßnahmen – von der Förderung eines unternehmerischen Mindsets bis hin zur Stärkung des Wagniskapitalmarkts – bieten die Maßnahmen eine ganzheitliche und konkrete Grundlage, um das europäische Start-up-Ökosystem auf ein zukunftsfähiges Level zu heben. Die Positionen gehen mit konkreten Handlungsempfehlungen einher, die den Marktzugang erleichtern, und die Innovationen in zentralen Zukunftsbereichen fördern sollen.
Dabei liegt die Verantwortung dafür nicht allein beim Staat, sondern in erster Linie in der Privatwirtschaft, die sich damit nicht mehr länger auf den Errungenschaften seiner industriellen Vergangenheit ausruhen kann. Vielmehr sollte sie unter Beweis stellen, wie stark sie an eine neue Innovationskraft des Standortes Deutschland glaubt.
Zur Autorin:
Silvia Hänig ist Unternehmerin und Inhaberin der Strategieberatung iKOM in München. Sie unterstützt nationale und internationale Tech-Unternehmen in Umbruchphasen bei kommunikativen Herausforderungen. Silvia Hänig ist seit 2022 Mitglied und Regional Lead für die Region München bei Encourage Ventures, dem größten Ökosystem für Team Diversity in der europäischen Gründer-Community. Das vollständige Positionspapier inklusive Handlungsempfehlungen kann hier heruntergeladen werden.