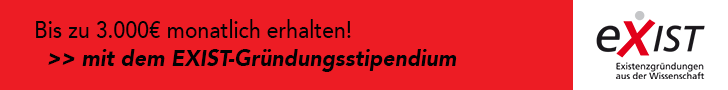Bildnachweis: PwC Deutschland.
Der 27. Oktober 2015 war der Tag, an dem sich die Kräfteverhältnisse im europäischen Start-up-Ökosystem nachhaltig verschoben haben. Der französische Staatspräsident Hollande hatte zur deutsch-französischen Konferenz „Beschleunigung des digitalen Wandels in der Wirtschaft“ in den Élysée-Palast eingeladen. Die Bundeskanzlerin war ebenso dabei wie die Wirtschaftsminister beider Länder. Den Wirtschaftsministern wurde ein Aktionsplan zur Stärkung der digitalen Transformation in Europa überreicht. Im Rückblick wird deutlich: Nur einer der beiden Minister hat das Papier offensichtlich nicht nur gelesen, sondern auch umgesetzt. In Frankreich wurde eine neue Start-up-Erfolgsgeschichte geschrieben, mit der klaren Handschrift des Wirtschaftsministers, der später Präsident wurde: Emmanuel Macron.
Die letzten zehn Jahre deutscher Start-up-Politik zeichnen hingegen ein ernüchterndes Bild: Es fehlt nicht an Erkenntnissen oder Konzepten, sondern an deren konsequenter Umsetzung. Deutschland kann sich diesen Stillstand nicht länger leisten. Eine ambitionierte und zukunftsgerichtete Start-up-Politik ist kein „Nice-to-have“, sondern ein Muss, um wirtschaftlich und technologisch zukunftsfähig zu bleiben. In einer Welt multipler Krisen brauchen wir eine Bundesregierung, die den Mut aufbringt, den Gründerinnen und Gründer täglich beweisen.
Krisen bieten Raum für Innovationen
Historisch betrachtet entstehen in Krisen oft die besten Innovationen: Kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase wurden in den USA Unternehmen wie Meta (damals: Facebook) und Tesla gegründet, die ganze Branchen revolutioniert haben; während der Finanzkrise waren es unter anderem Airbnb und Uber. In Deutschland sind Zalando und Delivery Hero Beispiele für Erfolgsgeschichten in schwierigen ökonomischen Zeiten, die belegen: Krisenzeiten setzen Innovationskräfte frei. Doch damit diese Dynamik Früchte trägt, braucht es politische Unterstützung. Gründergeist allein reicht nicht aus.
WIN-Initiative: Nichts außer Absichtserklärungen
Das gilt auch für die im vergangenen Herbst vorgestellte WIN-Initiative „Wachstums- und Innovationskapital für Deutschland“ – sosehr sie auch einen Nerv getroffen hat. Die Euphorie war groß: Endlich wurde wieder über Start-ups gesprochen! Wenn auch erst am Ende der Legislatur. Und das positive Narrativ hat für einen Moment darüber hinweggetäuscht, dass es wieder nur alter Wein in neuen Schläuchen war, der hier präsentiert wurde. Zusätzlich gibt es mit dem Aus der Ampel ein Problem: Der Korken steckt noch in der Flasche und außer Absichtserklärungen ist wieder nichts passiert.
Drei Maßnahmen für die nächste Regierung
Die neue Bundesregierung muss deshalb konkrete Maßnahmen zur Start-up-Politik in ihrem 100-Tage-Plan verankern. Neben der Umsetzung der WIN-Initiative gehören dazu drei Maßnahmen:
1. Die Superabschreibung für Mittelstand und Start-ups
Der Transformationsdruck auf die deutsche Wirtschaft ist enorm. Ein Win-Win für Start-ups und Mittelstand muss her: Die sogenannte Superabschreibung, eine Sonderabschreibung auf Digitalinvestitionen, würde nicht nur den Mittelstand stärken, sondern auch die Zusammenarbeit mit Start-ups fördern. Der IT-Verband Bitkom schlägt beispielsweise eine Abschreibungsquote von 175% auf Investitionen in digitale Güter und Sachwerte vor. Der Mittelstand könnte durch solche steuerlichen Anreize digitale Technologien schneller implementieren, während Start-ups als Anbieter dieser Technologien von einer höheren Nachfrage profitieren würden.
2. Massiv Kapital in Start-ups mobilisieren
Der Technologiestandort Deutschland kann sich keine Grundsatzdebatte um die Schuldenbremse leisten, ist aber auch nicht auf staatliche Geschenke angewiesen. Die Erfolgsgeschichte des High-Tech Gründerfonds (HTGF) zeigt, dass der Staat als Investor erfolgreich sein kann: Der HTGF ist das Ergebnis einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums, der Industrie und Branchenexperten und hat seit seiner Gründung 2005 über 750 Start-ups finanziert, mehr als 180 Exits realisiert und dabei eine signifikante Rendite erzielt. Er ist damit ein Paradebeispiel dafür, wie Public-private-Partnerships im Start-up-Ökosystem gelingen können. Wichtig ist für die neue Bundesregierung nun, den nächsten Schritt zu gehen und das Rückgrat des Venture-Ökosystems auszubauen: Neben KfW Capital und European Investment Fund (EIF) sollte ein Fund-of-Funds als Public-private-Partnership gegründet werden. Ein Teil der 24 Mrd. EUR, die im sogenannten Atomausstiegsfonds (KEFO) für die Endlagerung von Atomabfällen reserviert sind, könnte dort beispielsweise in Venture Capital fließen.
3. Defense- und Spacetech: Schlüsselbranchen fördern
Die Bundesregierung sollte gezielt in Defense- und Spacetech-Start-ups investieren. Die Vorteile liegen auf der Hand: Eigene Technologien reduzieren die Abhängigkeit und stärken die technologische Souveränität sowie die Widerstandsfähigkeit unserer Wirtschaft gegenüber externen Schocks. Diese Märkte bieten Potenziale für neue Arbeitsplätze und Exporterlöse. Innovationen aus diesen Sektoren wirken oft als Katalysator für technologische Entwicklungen in anderen Branchen, etwa durch neue Materialien oder KI-Anwendungen. Nicht zuletzt kann eine starke Präsenz in diesen Schlüsselbranchen internationale Investitionen anziehen und dadurch dazu beitragen, die Finanzierungslandschaft für Start-ups zu verbessern.
Fazit
Wagen wir zum Abschluss noch einmal den Blick zurück und auf den deutsch-französischen Vergleich: Im Jahre 2015 endete die Konferenz in Paris mit einer Gegeneinladung. Doch statt in das Bundeskanzleramt oder das Schloss Bellevue, führte die deutsche Einladung im folgenden Jahr in die faden Konferenzräume des Bundeswirtschaftsministeriums. Von Aufbruchstimmung war hierzulande keine Spur. Der nächste Kanzler sollte es anders machen.
Über den Autor:
Florian Nöll ist Partner und Global Venturing & EMEA Startups, Scaleups Leader bei PwC Deutschland. Er ist Experte für Start-ups, Corporate Innovation und die digitale Wirtschaft sowie Brückenbauer zwischen Technologiegründungen und etablierten Unternehmen. Er unterstützt Start-ups, berät Familienunternehmer, Geschäftsführer und Vorstände aus Industrie und Mittelstand und hilft ihnen dabei, in Technologiegründungen zu investieren. 2012 gründete er den Bundesverband Deutsche Startups e.V. und war bis 2019 dessen Vorsitzender.