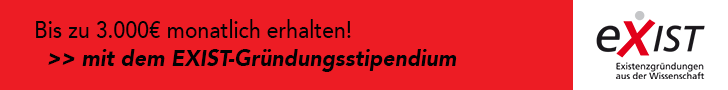Bildnachweis: WIPIT.
Wie weit die Identifizierungspflichten von Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) von Venture Capital- und Private Equity-Fonds bei Investments in Beteiligungsunternehmen reichen, wird in der Praxis völlig uneinheitlich gehandhabt. Eine Klärung durch die BaFin im Sinne einer allgemeinen Verwaltungspraxis wäre dringend angezeigt, um Beteiligungsprozesse zu beschleunigen und unnötigen Aufwand zu vermeiden.
Ausgangspunkt
Soweit KVGs im Fundraising tätig werden, sind von ihnen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 GwG Fondsanleger zu identifizieren. Ebenso ist unkritisch, dass im Fall einer Veräußerung der vom Fonds eingegangenen Beteiligung der Erwerber zu identifizieren ist. Völlig unterschiedlich beantwortet und behandelt wurde aber, wie weit der Kreis der zu identifizierenden Personen bei Eingehung einer Beteiligung zu ziehen ist. Dies liegt an dem in § 10 Abs. 1 Nr. 1, 11 Abs. 1 GwG verwendeten Begriff des „Vertragspartners“.„Vertragspartner“ werden im Fall eines Investments aufgrund der üblichen Gestaltungsformen einer Beteiligung auch Altgesellschafter und Co-Investoren.
Zu den Fallgestaltungen
Erfolgt das Investment zunächst als Überbrückungsfinanzierung über ein Wandeldarlehen und ist für die spätere Ausgabe von Geschäftsanteilen, in die das Darlehen „gewandelt“ wird, kein genehmigtes Kapital geschaffen, bedarf es für die Begründung des Wandlungsrechts des Abschlusses einer Stimmbindungsvereinbarung mit sämtlichen Gesellschaftern. Hierin verpflichten sich diese, eine Kapitalerhöhung unter Verzicht auf ein eigenes Bezugsrecht zu beschließen, in deren Rahmen dann die Einbringung der Darlehensforderungen erfolgt. In diesem Fall kommt der Wandeldarlehensvertrag nicht nur zwischen Darlehensgeber und Gesellschaft zustande, sondern auch unter Einbezug sämtlicher bereits vorhandener Gesellschafter, häufig einer Vielzahl. Da eine geldwäscherechtliche Identifizierung vor Begründung der Geschäftsbeziehung beziehungsweise vor Abschluss des Wandeldarlehensvertrags zu erfolgen hat, führt dieser Prozess zu erheblichen Verzögerungen, die vor allem dann, wenn ein Start-up-Unternehmen auf zeitnahe Finanzierung angewiesen ist, bestandsgefährdend wirken können. Auch im Fall eines Investments im Rahmen einer Eigenkapitalfinanzierungsrunde wird regelmäßig ein Beteiligungsvertrag nebst Gesellschaftervereinbarung außerhalb der Satzung abgeschlossen. Deren Parteien sind neben der Gesellschaft nicht nur die Investoren, sondern auch alle Altgesellschafter. Denn hier werden nicht nur die Konditionen für die Leistung des Investments geregelt, wie etwa Meilensteine, Garantien der Gründer und Altgesellschafter und deren Rechtsfolgen oder auch Verwässerungsschutz- und Liquidationspräferenzrechte, sondern auch, soweit nicht in der Satzung erfasst, Regelungen zum Verkauf, zu Informations- und Kontrollrechten der Investoren sowie zum Wettbewerbsverbot und Erfindungsschutz getroffen. Erwirbt ein Fonds eine Beteiligung an einem Unternehmen von einem Altgesellschafter (Secondary), ist auch dieser Erwerb in der Regel nicht freigestellt, sondern Voraussetzung ist, dass die Beteiligungsgesellschaft dem neben der Satzung bestehenden Regelwerk einer Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung beitritt – denn an die dort vorgesehenen Sonderrechte bereits beteiligter Investoren müssen alle Gesellschafter gebunden sein, auch spätere Anteilserwerber. Zwar bindet die Satzung automatisch alle Neugesellschafter, nicht aber aufgrund ihrer Vertragsnatur die Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung. Hier bedarf es eines ausdrücklichen Beitritts, durch den die Altgesellschafter zur „Vertragspartei“ des Erwerbers werden.

Geldwäscherechtliches Verständnis des „Vertragspartners“
Entscheidend ist also die Frage: Kommt es für den Kreis der zu identifizierenden Parteien entsprechend dem Wortlaut darauf an, wer vertraglich aus Anlass eines Investments eingebunden wird, also auch Alt- oder Neugesellschafter, oder nur darauf, wo und in welchem Verhältnis der Geldfluss stattfindet. Richtigerweise ist geldwäscherechtlich nicht jeder zu identifizieren, der nur in irgendeiner Art und Weise indirekt vertraglich mit dem Geldfluss verbunden ist. Vielmehr ist es nur diejenige Partei, mit der eine dauerhafte Geschäftsbeziehung im Sinne von § 1 Abs. 4 GWG eingegangen wird. Voraussetzung einer Geschäftsbeziehung ist, dass sie unmittelbar in Verbindung mit der Aktivität des Verpflichtenden stehen muss. „Unmittelbar“ in Beziehung zur Investmenttätigkeit einer Beteiligungsgesellschaft steht aber nur das Eingehen der Beteiligung selbst und somit die Zuführung des Beteiligungskapitals gegen Anteilserwerb. Auch die europäische Geldwäscherichtlinie spricht nicht von Sorgfaltspflichten gegenüber Vertragspartnern, sondern von „Kunden“. „Kunde“ im geldwäscherechtlichen Sinne ist nur die Gesellschaft, an der die Beteiligung begründet wird. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin (AuA) enthalten zwar keine Aussage zur besonderen Gestaltung des Beteiligungsgeschäfts, lassen aber in Ziff. 4.1, Abs. 4 AuA erkennen, dass zu Geschäftsbeziehungen nicht solche zählen, die nicht auf einer unmittelbaren Vertragsbeziehung zu Kunden beruhen (genannt sind dort beispielhaft Mieter einer Immobilie aus einem Immobilienfonds, Vertragspartner von Immobilientransaktionen oder Dienstleister im Zusammenhang mit der Verwaltung von Investmentvermögen). Die Beziehung zu den Altgesellschaftern oder Co-Investoren im Fall einer Unternehmensbeteiligung ist in vergleichbarer Form nur mittelbarer Art. Diese Vereinbarungen dienen allein gesellschaftsrechtlich der späteren Umsetzung der Beteiligung durch die Kapitalerhöhung beziehungsweise regeln satzungsähnlich das weitere Miteinander der Gesellschafter. Auch ohne Abschluss einer Beteiligungs- oder Gesellschaftervereinbarung könnte das Investment durch eine bloße Agio-Zahlung an die Gesellschaft im Rahmen eines Kapitalerhöhungsbeschlusses umgesetzt werden. Die vertragliche Auslagerung bestimmter Regelungen außerhalb der Satzung erhöht die geldwäscherechtlichen Risiken nicht und kann daher geldwäscherechtlich keinen Unterschied machen. Gleiches gilt für ein Wandeldarlehen, da es auch hier keiner weiteren Stimmbindungsvereinbarungen bedürfte, wenn die Wandlung durch genehmigtes Kapital abgesichert ist.
Wünschenswerte Klärung
Das für Geldwäscheprävention zuständige Referat der BaFin hat zwar vor Kurzem auf Anfrage in einem konkreten Mandat bestätigt, dass in diesen Szenarien Altgesellschafter oder Co-Investoren nicht zu identifizieren sind, da keine geldwäscherechtlich relevante Vertragsbeziehung vorliegt. Die BaFin hat sich aber ausdrücklich eine Veröffentlichung einer entsprechenden Verwaltungspraxis vorbehalten. Es wäre im allgemeinen Interesse der Beteiligungsbranche und im Interesse der Rechtssicherheit wünschenswert, wenn dies zeitnah geschehen würde.
Über den Autor:
Dr. Wolfgang Weitnauer ist Gründungspartner der Kanzlei WIPIT Partnerschaft mbB Rechtsanwälte Steuerberater in München. Zum Jahresbeginn startete die Boutiquekanzlei WIPIT mit Standorten in Berlin, Mannheim und München in den Rechtsberatungsmarkt. WIPIT ist ein Zusammenschluss der Sozietät Weitnauer mit einem auf Technikrecht spezialisierten Spin-off von Büsing Müffelmann & Theye.